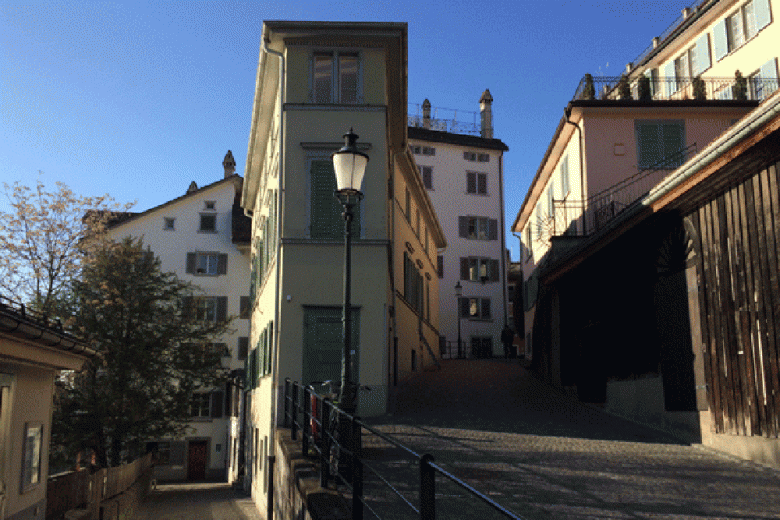‹Form follows function› bedeutet Platzverschleiss
«Wie Stoffreste beim Zuschneiden eines Kleides»
Inge Beckel
19. März 2015
Das Gebot der Stunde in den Zentren heisst verdichten – darüber herrscht Konsens. Entsprechend gilt der Kampf der Zersiedelung. Dass ein Grund der gegenwärtigen Misere aber in den Maximen der Moderne selbst zu suchen ist, bleibt oft unerwähnt.
Eine Frage der Belegungsdichte
Die Form sei aus der Funktion zu entwickeln, so das Credo «form follows function». Vergleichbar etwa mit der Hülle eines alten Fotoapparates , dem das Objektiv vorgelagert ist, lernte man noch in den 1980er-Jahren an der ETH in Zürich; ändern Inhalt oder Funktion, so ändert die Hülle. Nur brauchen wir, wenn wir dieser Maxime folgen, enorm viel Platz. Denn der Raum, in dem wir essen, steht ausserhalb der Essenszeiten leer. Das Schlafzimmer ist nur nachts belegt. Der Wohnraum nur, wenn wir Zeit zum Wohnen haben, also an Wochenenden und eventuell ein paar Stunden abends. Dieser Ansatz wurde in der Architekturgeschichte grundsätzlich funktionalistisch genannt, so etwa von Adolf Behne (1885–1948).
Demgegenüber besagt der rationalistische Ansatz, dass ein Raum sowohl zum Schlafen, zum Essen als auch zum Wohnen genutzt werden kann. Der Entscheid, wie ein Zimmer eingerichtet und also genutzt wird, liegt bei der Bewohnerin oder beim Bewohner. Ist aber eine Wohnung klein, kann – respektive muss – in ein- und demselben Raum sowohl geschlafen als tagsüber auch gewohnt werden. Oder denken wir beispielsweise an die Enfilades in den Blockrandbauten der Gründerzeit um 1900, so sind Grösse und Proportion der aneinander gereihten und miteinander verbundenen Räume oft fast gleich. Ändert die Nachfrage auf dem Markt, kann in einer derartigen Wohnung ein Büro eingerichtet werden.
Die Hülle, also der eigentliche Raum, in derartigen Häusern ist grundsätzlich neutral gestaltet. Gleichzeitig haben die Architekten darauf geachtet, die Proportionen ausgewogen auszuformulieren und konstruktiv wie atmosphärisch gute Materialien auszuwählen. Dieses Vorgehen öffnet den Fächer der Nutzungen oder Funktionen, die in einem derart gestalteten Raum möglich sind. Nutzungsdauer und letztlich Belegungsdichte von Räumen werden damit tendenziell erhöht. Wirtschaftlich gesprochen, ist deren Auslastung besser. Dieser rationalistische Ansatz, Räume und Häuser auszugestalten, ist im Vergleich zu funktionalistisch ausformulierten Bauten schliesslich auch nachhaltiger.
… oder in Venedig.
Villen ohne Park
Dieselben Überlegungen lassen sich auf der städtebaulichen Ebene machen, also in einem viel grösseren Masstab. Klassische Zonenpläne scheiden Wohnzonen oder Industrie- und Gewerbe- oder Dienstleistungszonen aus. Zonen für öffentliche Bauten. Und Freihaltezonen. So will es die modernistische Stadtplanung, wiederum nach dem Leitgedanken von form (oder situation) follows function. Und da darf in einer veritablen Wohnzone nicht gearbeitet werden. Soll aber ein stillgelegtes ehemaliges Fabrikgelände in eine gemischte Wohn- und Dienstleistungszone umgewandelt werden, braucht es entsprechende Änderungen in den Zonenplänen. Und diese dauern in der Regel viele Jahre.
Wiederum ist klar, dass das räumliche Nebeneinander von Industrie- und Wohnzonen Platz braucht. Viel Platz. Es widerspiegelt ein additives, linerares Denken. Auf den (zweidimensionalen) Plänen suggeriert es auch Ordnung: (ruhiges) Wohnen und (lärmiges oder stinkendes) Produzieren sind getrennt. Dass durch ein solches Denken aber unzählige Dorf- wie Stadteinfahrten von schlecht gestalteten, wenn nicht schlicht hässlichen Lagerplätzen und Billigstproduktionshallen charakterisiert werden, hat sich erst später gezeigt. Daran haben die modernen Stadtplaner nicht gedacht. Sicherlich ist es richtig, Kamine mit giftigen oder jedenfalls stinkenden Emissionen nicht neben Wohnbauten zu platzieren.
Nun waren es just gesundheitliche Überlegungen, die die Väter der modernen Stadtplanung die Häuser weit voneinander bauen liessen. Denn möglichst alle Räume sollten von Sonnenlicht geflutet werden können, alle mit Frischluft versehen werden. Nicht stinkende Abwassergräben und dunkle Gassen sollten die Häuser umgeben – nein, gesunde Grünräume! Le Corbusier prägte das Bild der Villen im Park. Nun sind im Laufe der Jahrzehnte und vor dem Hintergrund des Rufs nach Verdichtung die Grünräume um die Villen oder Häuser jedoch geschrumpft – und nochmals geschrumpft. Heute sind es oft nur noch gassenartige grüne Resträume, denen meist jede aussenräumliche Qualität fehlt.
Erschliessungsraum als urbaner Aussenraum.
Verdichten bedeutet Komplexität
Verdichten bedeutet also einerseits – auf einer kleinmassstäblichen, architektonischen Ebene –, Räume mehrfach nutzen zu können. Zum Essen, Schlafen, Arbeiten und zum Verweilen. Und andererseits – auf einer grossmassstäblichen, städtebaulichen Ebene – ein Haus nicht mehr primär als Villa oder Objekt im Park zu verstehen. Natürlich brauchen wir Grünräume und Parkanlagen. Aber diese sollen grundsätzlich gemeinschaftlichen Charakter haben. Und natürlich brauchen wir private Aussenräume. Doch diese sind die heute in der Regel grossen Balkone oder Loggien. Oder auch kleinere private Gärten. Oder allenfalls Schrebergärten.
Gleichzeitig bedeutet verdichten, dass Aussenräume von (vermeintlich) grünen Naturräumen oder Parks wieder zu urbanen Räumen werden. Zu kleinen Wegen oder Gassen und auch zu Plätzen. Denn just vormoderne Erschliessungsräume, also zum Beispiel mittelalterliche Gassen, waren multifunktional angelegt. Also Aussenräume, die mehrere Funktionen hatten – und noch haben. Einmal dienen sie als Erschliessungsraum für den Gang vom Herkunfts- zum Zielort. Dann dienen sie als Ort für den kurzen Schwatz mit der Bekannten, der man auf dem Weg zufällig begegnet. Oder nehmen wir eine Treppe. Sie kann neben der Erschliessung auch dem Verweilen dienen.
Nun können dichte Räume verunsichern. In Gassen verliert man schnell den Überblick. Denn ein dichtes Nebeneinander von Häusern lässt die Durchblicke schrumpfen oder gar schwinden. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass dichte Geflechte aus Gassen und kleinen Plätzen den Ansässigen und Einheimischen Vorteile bieten. Wer sich auskennt, verläuft sich nicht. Fremde müssen, verlieren sie die Orientierung, fragen. Das erhöht die Möglichkeit, dass sich Einheimische und Fremde austauschen. Dies wiederum reduziert die Unsicherheit, denn der Fremde fühlt sich schon ein bisschen heimisch – richtig und wichtig ist, der Umgang mit engen urbanen Räumen, mit dicht aneinander gebauten Häusern, will (wieder) gelernt sein.
Wie Stoffreste beim Zuschneiden eines Kleides
Zum Thema – aber aus anderer Perspektive und mit anderer Erfahrung – ein Zitat aus dem Roman Accabadora der italienischen Autorin Michela Murgia (Berlin 2010, S. 130):
Maria «war ein wenig unsicher, aber neugierig auf die grosse Stadt. Signora Gentili hatte ihr die merkwürdige Geschichte von den quadratisch angelegten Strassen Turins erzählt, die anscheinend geplant worden waren, bevor man die Gebäude errichtet hatte, zu denen sie führen sollten. […] Diese millimetergenaue Ordnung war für sie unvereinbar mit dem gesunden Menschenverstand, sie war überzeugt, dass die einzig richtige Art, Strassen anzulagen, die von Soreni war, wo sie aus den Häusern selbst entstanden waren, wie Stoffreste beim Zuschneiden eines Kleides.»