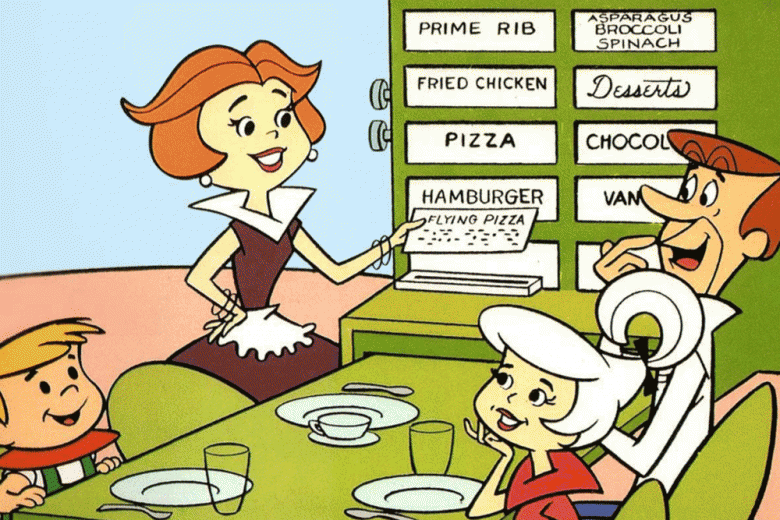Lowtech: komplexer in der Planung, einfacher im Unterhalt
Inge Beckel
7. April 2016
Hightech im Alltag, aus der Sicht des letzten Jahrhunderts. Bild: Frick/eco-bau.
Gebäudeautomation ist in aller Munde. Eine neuerliche Technologisierungswelle steht an. Wo ist sie berechtigt? Was macht Sinn? Wo ist weniger mehr? Hightech oder Lowtech – oder beides? Eine Fachtagung hat sich dem Thema angenommen.
Die Frage der Tagung, abgehalten Mitte März in Bern, lautete: Wieviel Technik braucht nachhaltiges Bauen? Womit angedeutet war, dass es nicht allein um die neuesten Errungenschaften in den technischen Entwicklungen von Smarthome oder Building Information Modelling (BIM) ging, sondern eben um die breit gestellte Frage: Wieviel Technik brauchen Häuser heute generell? Träger der Fachtagung waren Eco-bau, Nachhaltigkeit im öffentlichen Bau, und NNBS, das Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz.
Auf den Spuren von Jacques Tati
Karin Frick vom Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) hielt das Einleitungsreferat. Sie meinte, dass die Ankündigung des Smarthome im Grunde nichts Neues ist – denken wir etwa an Jacques Tati und seinen Film Mon Oncle oder dergleichen. Schon im Jahre 1958 zeigten dort die stolzen Besitzer ihr neues Heim den ankommenden Gästen, wobei beispielsweise der Springbrunnen im Vorgarten gerade noch rechtzeitig per Knopfdruck in Gang gesetzt wird, um die Besucher in bewunderndes Staunen zu versetzen. Frick zeigte auf, dass nach jeder Innovation ein Hype oder eine Art Hyperaktivität einsetzt, die sich nach einem Höhepunkt wieder senkt. Gewisse Neuerungen festigen sich dann und etablieren sich auf mittlerem Niveau. Mon Oncle wird also Realität, nicht aber in seiner ganzen Bandbreite. Frick sprach weiter davon, dass unter den Skeptikern vor allem Bauingenieure und Architekten zu finden sind, während es sich bei den Befürwortern naheliegenderweise um Elektroplaner und Gebäudetechniker handelt. Hürden auf dem Weg zum Smarthome sind mitunter seine Störungsanfälligkeit, die Komplexität der Bedienung, aber auch fehlendes Kundeninteresse.
Eine Auslegeordnung nachhaltigen Bauens
Volker Ritter, Architekt und Forscher, hat sich im Rahmen einer Studie an der Universität Liechtenstein mit der Frage des Verhältnisses von Technik und Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Dabei wird primär klar, dass die Begriffe Hightech wie Lowtech nicht eindeutig definiert sind und nicht alle Leute dasselbe darunter verstehen. Vorteile von Hightech liegen in der Kontrolle, respektive in der Regulierbarkeit, des häuslichen Komforts, während Lowtech-Systeme generell robuster und wartunsgfreier, und wohl für die Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer einfacher in der Handhabung sind. Will Lowtech gelingen, erfordert dies aber aufwändige Planungsprozesse, was – logistisch betrachtet – wieder in den Bereich von Hightech kommt. Interessant war die Gegenüberstellung von so genannt "allochtonen" Gebäuden gegenüber "autochtonen": Allochtone Bauten sind hochtechnisierte, in sich geschlossene Systeme, die den Kontext ignorieren, respektive ausblenden. Autochtome Bauten demgegenüber sind kontextabhängig, und gehen auf sozioökonomische und vor allem klimatische Rahmenbedingungen ein.
Allochtone Bauten. Bild: Ritter/eco-bau.
Autochtone Bauten. Bild: Ritter/eco-bau.
Bauteuerung von 30 Prozent in 15 Jahren
Andreas Hofer, Architekt und Genossenschaftspionier der jüngsten Generation, berichtete über Erfahrungen in Zusammenhang mit der Genossenschaftssiedlung "Mehr als wohnen" in Zürich Nord. Spannend ist, dass er diese Ergebnisse mit jenen aus dem Bau vom Kraftwerk1 vergleichen kann. So haben sich die Neubaukosten in der fraglichen Zeitspanne von knapp 15 Jahren – das Kraftwerk1 wurde 2001 bezogen, "Mehr als wohnen" im Herbst 2015 –, von rund 2740 Franken pro Quadratmeter Hauptnutzfläche auf 3860 erhöht. Der Konsumentenpreisindex ist zeitgleich um 8,4 Prozent gestiegen. Wertbereinigt beträgt die Bauteuerung damit 30 Prozent, wobei die beobachtete Steigerung nicht daran liegt, dass die Anforderungen der Bauträger, respektive der Bewohnerschaft, in den 15 Jahren derart gestiegen sind. Nach Hofers Erfahrung liegt ein Grund in den komplexer werdenden Planungs- und Bauprozessen; eine Beobachtung, die Ritter teilt. Ein weiterer Grund liegt in den gestiegenen gesetzlichen und normativen Anforderungen, die heute zwingend zu erfüllen sind: von Auflagen des Umwelt- und Gesundheitsschutzes der Stadt Zürich, bis zu erhöhten Auflagen an die Erdbebensicherheit, wofür unter anderen der SIA mitverantwortlich zeichnet. Somit schrumpft der Spielraum für die Bauträgerschaften insgesamt. Mit anderen Worten: Normative und gesetzliche Vorgaben unserer verstärkt nach Sicherheit verlangenden Gesellschaft machen das Bauen jenseits der Frage nach Low- und Hightech teuer.
Mit Pragmatismus zur Energiewende
Anhand der Siedlung Dettenbühl in Wettswil am Albis zeigte Martin Ménard von Lemon Consult eine Sanierungsvariante auf Lowtech-Ebene auf. Seine Erfahrung ist, dass bei Sanierungen eigentlich nie Hightech-Lösungen gefragt sind. Vielmehr werden Lowtech-Varianten gesucht, die in Etappen umgesetzt werden. Generell geht es um die Sanierung von Küchen und Bädern, die Erneuerung der Steigzonen, um Fensterersatz, die Dämmung der Dächer, und allenfalls um den Ersatz von Heizsystemen. Hinsichtlich Wärmebedarf wurden in Wettswil Verbrauch und Kosten über gezielte Eingriffe bei Fassaden und Fenstern in einem ersten Schritt erheblich gesenkt. Eine weitere Verbesserung bedeutete die Sanierung von Dach und Lüftungssystemen. Dabei wurden technisch gesehen auch derart niederschwellige Lösungen wie ein Aussenluftdurchlass eingebaut, wie im Bild gezeigt – ganz ohne technische Steuerung. Erneut zeigt die Erfahrung Ménards, dass normative Vorgaben die Kosten belasten können: Zum Beispiel, wenn Zielwerte nach SIA 2040 herangezogen würden, was im gezeigten Fall nur über einen Ersatzneubau nach Minergie-P-Eco erreicht worden wäre, wobei die effektiv erreichten Werte in Dettenbühl nur geringfügig unter den SIA-2040-Vorgaben liegen. Ménard meinte, dass Lowtech-Erneuerungen als Beitrag zur Energiewende unterschätzt würden.
Stichworte zur Genossenschaftssiedlung Mehr als Wohnen. Bild: Hofer/eco-bau.
Lowtech oder Hightech? Beides!
Neben den erwähnten Beiträgen wurden an der Berner Tagung weitere Inputs zu energieeffizienten, nachhaltigen Bauten und Systemen gezeigt. Beispielsweise das 2226 genannte Bürogebäude in Lustenau der Architekten Baumschlager Eberle, dessen Aussenmauern eine Gesamtwandstärke von stolzen 76 Zentimetern und einen Fensteranteil von nur 22 Prozent aufweisen. Der Bau hat keinerlei Heiz- und Kühlanlagen, keine Lüftungsanlage – ausschliesslich die Fensterflügel sind CO2- und temperaturgesteuert. Ausführlich vorgestellt wurde auch der Swisscom-Businesspark in Ittigen von Atelier 5 Architekten und Planer, zusammen mit Ernst Basler und Partner. Dessen zentrales mehrgeschossiges Atrium fungiert als eigentliche Baukörper-Lunge, was den Bedarf an Technik massiv reduziert, trotz Minergie-P-Eco-Standard.
Ein mögliches Fazit der Tagung lautet, dass Bauen in der Schweiz heute ohne einen gewissen Anteil an Steuerungen und Hightech nur in Ausnahmefällen möglich ist, aber dass es gleichzeitig vernünftige Lösungen von sich ergänzenden, kombinierten Systemen aus High- und Lowtech gibt. Somit kann der Anteil an störungsanfälliger, hochentwickelter Technologie gesenkt werden, was weniger Unterhalt bedeutet. Gleichzeitig erhöht sich der Planungsaufwand.
Vgl. zum Thema weiter etwa Die BIM-Offensive von Manuel Pestalozzi.